Endlich mal ein Strafzettel
Und wieder Besuch aus Deutschland
7.6.2016 - Pontdrift (62743 km)

Je weiter ich in den Norden Südafrikas vordringe, desto unkomplizierter wird das Verhältnis zwischen Schwarzen und Weißen. Der Abstecher nach Lesotho war ein erster Ausflug in das normale Afrika. Das Land ist vollständig umgeben von der Republik Südafrika, es könnte sich eigentlich sehr ähnlich anfühlen. Doch Lesotho hat nie eine Apartheid erlebt, es gibt nicht diese Verbitterung der Schwarzen gegenüber den Weißen. Hier sprechen mich Afrikaner von sich aus an, man begegnet sich auf gleicher Höhe. Es gibt nicht diese zwei Parteien, die sich meiden. Durch Lesotho zu reisen, ist eine Wohltat nach den Wochen in der verklemmten Atmosphäre Südafrikas.


Andere Reisende, mit denen ich über das gespannte Verhältnis zwischen den Bevölkerungsgruppen sprach, sagten, im Inland sei es schlecht, an der Küste besser. Das kann ich nicht bestätigen. Besser wird es in Richtung Afrika, in Richtung des wirklichen Afrika, in Richtung Norden. Die Schwarzen wirken hier nicht gebrochen, sind nicht immer nur als Diener der Weißen zu sehen, sie haben ihren Stolz. Auch hier sagen sie oft höflich "Sir" zu mir, aber sie zucken nicht zusammen, wenn ich sie zuerst mit "Sir" anrede.

Swaziland ist eines der kleinsten Länder auf dem afrikanischen Kontinent, etwa so groß wie Sachsen, ungefähr halb so groß wie Lesotho. Von Südafrika wird es zu drei Vierteln umgriffen, die nordöstliche Region grenzt an Mozambique. Swaziland wirkt gleich auf den ersten Blick besser entwickelt als das rückständige Lesotho, es ist wirtschaftlich näher dran an Südafrika. Und es hat - wie es sich für ein modernes Land gehört - strenge Regeln.

"Wir überprüfen, ob die Fahrzeuge in gutem Zustand sind", erklärt er. - "Na klar, meins ist in einem sehr guten Zustand." Ich bin gut gelaunt und denke nicht im Entferntesten daran, dass sie mich irgendwie belangen könnten oder gar wollten. Mir als Radler gegenüber waren Straßenpolizisten weltweit immer freundlich eingestellt. Auch in Ländern wie Kasachstan, wo Motorrad- und Autofahrer über Schikane klagten. Wenn mich dort die Polizei anhielt, dann nur, um mit mir zu plaudern, vor allem zu erfahren, woher ich komme.
Der Polizist, der mich jetzt im Royal Kingdom of Swaziland gestoppt hat, fragt aber nicht nach meiner Herkunft. Stattdessen fasst er an die Krempe meines Sonnenhutes und wackelt prüfend daran. Dann sagt er: "Sie haben keinen Helm auf."
Einen Helm? Das letzte Land, in dem ich einen hätte tragen müssen, war Kanada. Vor fast zwei Jahren. Aber da hat sich niemals jemand daran gestört, dass ich ohne unterwegs war. Und jetzt hier, in Afrika, in Swaziland, soll das ein Problem sein?

Strafe zahlen... ich kann es noch immer nicht glauben. "Nun gut, wenn Sie mir eine Quittung geben. Wie viel kostet es eigentlich?"
"60 Emalangeni." - Aha. Das sind etwa 3,70 Euro.
Er bittet mich auf die andere Straßenseite, wo wir uns in ein Bushaltestellenhäuschen setzen. Während er den Beleg vorbereitet, ziehe ich meinen Notizblock und den Kugelschreiber aus der Lenkertasche. Setze mich wieder auf die Bank und schreibe erst einmal Datum und Uhrzeit auf. Einfach nur, um irgendetwas aufzuschreiben. Die Show erzielt den gewünschten Effekt. Die Männer fragen, was ich da tue.
"Naja, ich muss mir ja notieren, wo und wann Sie mich gestoppt haben. Ich brauche dann noch Ihren Namen und den Polizeiausweis."
Sie sind zwar kurz irritiert, bleiben aber cool. Einer von ihnen zeigt mir den Ausweis, und der sieht gut aus. Er steckt in einer Lederhülle, die mit einem schweren, metallenen Stern versehen ist. Der Polizist, Diamini Thabo, schreibt mir außerdem noch den Namen seines Kollegen auf und dessen Identifikationsnummer: 5715.
Nummer 5715 sitzt auf der Bank des Bushaltestellenhäuschens und fragt ganz ruhig, ob ich nun alles notiert hätte. Dann möge ich doch jetzt bitte näherrücken, damit wir seinen Beleg ausfüllen können. Das tun wir, er will nur meinen Namen und das Land. Er behält die Durchschrift und gibt mir das nummerierte Original des Strafzettels mit den Worten: "Damit können Sie in Mbabane zur Polizeistation gehen. Sie werden sehen, dass alles seine Richtigkeit hat."

Während sich die Bergabfahrt lang fortsetzt, fällt mir ein, dass mir eine Viertelstunde zuvor ein Einheimischer mit dem Fahrrad begegnet war - natürlich ohne Helm. Es hätte mich aus dem Sattel geworfen, wenn mir hier jemand auf einem einfachen afrikanischen Rad mit Helm entgegengekommen wäre. Nun begegnet mir ein weiterer Radfahrer. Auch er ohne Helm. In Afrika habe ich noch nie einen Landbewohner mit Helm gesehen. Klar, es gab Mountainbiker in Südafrika oder Rennradfahrer in Eritrea, die hatten Helme auf. Aber doch nicht den Bauern, der mit einem Helm vom Feld nach Hause radelt.
Natürlich, jetzt geht es mir auf! Sie haben mein Fahrrad für ein Moped gehalten. Das ist schon häufig passiert. An Grenzen zum Beispiel, wo man mich nach dem Nummernschild fragte und dann einen zweiten Blick auf mein Fahrzeug warf: "Ach so? Das ist ein Fahrrad?" - Oder wenn man mir sagte, dass es nach dortunddort noch eine Stunde sei. Und ich dann fragte: "Nur eine Stunde? Mit dem Fahrrad?" - Auch dann Erstaunen: "Ach so? Das ist ein Fahrrad?"
Abends erzähle ich die Geschichte dem Manager des Backpacker Hostels nahe der Hauptstadt Mbabane. Er bestätigt, dass es in Swaziland eine Helmpflicht für Radfahrer gibt, diese Regelung aber eigentlich nicht durchgesetzt wird. Ich hole mein Souvenir heraus und schaue genau hin. Tatsächlich, da steht es doch: "Cycling without helmet".

Nur ein paar Etappen werde ich noch allein durch Südafrika fahren, das Zusammentreffen mit Gertrud steht vor der Tür. Gertrud hat mich - zusammen mit Walter und Jörg - vor drei Jahren von Erlangen bis nach Wladimir in Russland begleitet. Nun hat sie sich elf Wochen Zeit genommen, um von Durban nach Lusaka zu radeln. Einen Teil der Strecke werden wir zusammen fahren.
Die Startschwierigkeiten hat sie inzwischen überwunden. Die ersten Tage in dieser anderen Welt waren schwer für sie. Man mag von der Kriminalität in Südafrika in Reiseführern gelesen haben, man mag vorab gewarnt worden sein - wie ernst die Lage aber wirklich ist, kann man offenbar erst vor Ort erkennen.
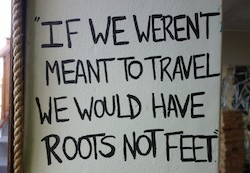
*) gemeint ist der Staat Südafrika - in den umliegenden Ländern im südlichen Afrika ist die Lage wesentlich besser.
In Graskop, im Nordosten des Landes, treffen unsere Wege zusammen. Innerhalb kurzer Zeit der zweite Besuch aus dem Frankenlande. Vor wenigen Tagen erst habe ich mich im Krüger-Park von Inge und Helmut verabschiedet (siehe -> letzten Bericht).
Von Graskop aus sind es nur noch ein paar Hundert Kilometer durch Südafrika bis nach Zimbabwe. Wir verbringen hier einen Tag mit der Routenplanung und weiteren Vorbereitungen. Am Abend findet Gertrud auf der Seite des Auswärtigen Amtes eine ganz aktuelle Nachricht: Dem Staat Zimbabwe gehen die Dollars aus. Vor 15 Jahren hat das Land eine Hyperinflation erlebt und daraufhin 2009 den US-Dollar als offizielle Währung eingeführt. Doch die wirtschaftlichen Schwierigkeiten, eine Folge der wankelmütigen Politik des greisen Präsidenten Mugabe, hat das nur bedingt lindern können, die Talfahrt ging weiter. Einheimische können seit einigen Tagen nur noch limitiert Geld abheben, internationale Geldkarten funktionieren überhaupt nicht mehr, wie es heißt.

Wir müssen uns also bereits in Südafrika mit US-Dollars eindecken. Ich ahne schon, dass das schwierig werden könnte. Die Geldautomaten werden uns wohl genügend südafrikanische Rand ausspucken. Aber werden wir, als Ausländer, dafür Dollars kaufen können? Gertrud sieht das gelassen: Warum sollten sie uns keine Dollars geben? - Warum nicht? Weil wir in Afrika sind. Weil hier eine eigene Logik herrscht.
Sicherheitshalber frage ich per Mail schon mal bei meinem Freund und Banker Tilman nach, ob ein Geldtransfer möglich ist. - Nach Zimbabwe bestimmt nicht, schreibt er zurück, wegen der Sanktionen. Nach Südafrika könnte er Dollars überweisen. Aber die würden möglicherweise nur in Rand ausgezahlt. Das würde uns natürlich nichts nutzen.
Nach einigen Tagen durch einsame Gegend ohne Banken kommen wir in der Stadt Tzaneen an. Der erste Weg führt zur Standard Bank. Eine Viertelstunde warte ich am Infoschalter, bekomme dann die Auskunft, dass es Fremdwährungen an Schalter No. 1 gibt. Dort eine halbe Stunde warten. Um schließlich zu erfahren, dass die Bank keine US-Dollars vorrätig hat. Man muss sie bestellen, in einer Woche sind sie da. Aber vielleicht hat ja die Konkurrenz, Absa oder FNB, Dollars zur Hand.

Inzwischen ist es fast 16 Uhr, die Banken sind geschlossen. Am nächsten Morgen erfahren wir auf der Absa Bank, dass sie sogar zwei Wochen brauchen, um Dollars aufzutreiben. Also zur FNB. Und da gibt es Hoffnung. Bis morgen können sie liefern, auch an uns als Ausländer. Also werden wir einen weiteren Tag in Tzaneen verbringen.
Eine Viertelstunde vor Öffnung stehen wir am nächsten Morgen vor der FNB, die Taschen voller südafrikanischer Rand, die wir gestern am Automaten abgehoben haben. Große Freude, als wir hören, dass die Dollars tatsächlich angekommen sind. Doch dann erste Schwierigkeiten: "Haben Sie ein Konto bei der FNB?" - "Leider nicht, wir reisen nur ein paar Wochen durch Südafrika." Man scheint uns das aber zu verzeihen.
Nächste Probe: "Haben Sie die Rand in Südafrika bezogen?" - "Ja, aus ATMs." - "Haben Sie die Quittungen?" - Puh, zum Glück habe ich sie aufgehoben. Der Bankangestellte kopiert sie, wie zuvor schon den Reisepass.
Unterdessen tippt seine Kollegin meine Passdaten, die Heimatadresse und die Adresse hier in Tzaneen in den Computer ein. Doch das reicht nicht. Ein Flugticket muss her.

Also versuchen wir nun, alles mit Gertruds Daten abzuwickeln. Sie hat ja die Flugtickets Frankfurt-Durban und Lusaka-Frankfurt. Doch der Computer ist auch damit nicht zufrieden. Wahrscheinlich, weil kein Flug in ein Dollar-Land dabei ist.
Nur gut, dass uns der ältere, erfahrene Angestellte sehr wohl gesinnt ist. Andere hätten in Gleichgültigkeit längst vor dem Computer kapituliert. Der Mann kennt unsere Geschichte und will uns wirklich helfen. Während er am Computer vorbei mit seinem Chef in der Provinzhauptstadt verhandelt, sitzen wir bedröppelt da und warten.
Ein Kunde aus der Schlange vor dem Schalter spricht uns an: "Ihr schaut aber sehr frustriert drein! Was ist denn los?" Wir erzählen ihm, dass es nicht leicht ist, Dollars zu bekommen. - Ja, das weiß er. Warum wir die denn brauchen, fragt er. - Weil wir nach Zimbabwe fahren und es dort derzeit kein Bargeld gibt. - Er sagt, das Land liege am Boden, dort gebe es auch sonst nichts: "No money, no fuel, no food!"
Nach knapp einer Stunde kommt die erlösende Nachricht: Wir dürfen die Dollars kaufen. Seinem Chef gegenüber hat der Angestellte gelogen, dass wir mit dem Auto nach Zimbabwe einreisen. Eine Autonummer hat er sich auch schon ausgedacht. Ich übernehme sie in die handschriftliche Erklärung, mit der ich unseren Dollarkauf begründen muss. Zum Abschied bedanken wir uns herzlichst bei dem guten Mann. Ohne sein Engagement würden wir jetzt dicke Backen machen.

Noch zwei Tagesetappen sind es bis zur Grenze. Fast genau auf dem Wendekreis des Steinbocks - wo die Sonne auf ihrem jährlichen Weg im Süden umdreht, um in den Norden zurückzukehren - überholt uns bei Morebeng Sarah mit ihren beiden Söhnen im Auto. Auf dem Heck ist ein Träger mit einem Fahrrad montiert. Die ganze Familie ist fahrradbegeistert, erfahren wir. Sarah lädt uns zu sich nach Louis Trichard ein.
Ihr Haus und das Grundstück sind riesig, zumindest nach deutschen Maßstäben. Sarah ist Unternehmerin, führt eine Fabrik zur Verwertung der Früchte des Baobabs. Neben der Schirmakazie ist der Baobab der Charakterbaum in der afrikanischen Savanne, mit einem dicken Stamm und Zweigen, die nur wenige Blätter haben und eher wie Wurzeln aussehen. Große Baobabs haben einen Umfang von 20 Metern und sind etliche Hundert Jahre alt. Erst nach 200 Jahren trägt ein Baobab Früchte, wie Sarah uns erklärt. Sie trocknet die vitaminreichen Früchte, verarbeitet sie zu Pulver und bietet das Produkt vor allem auf dem europäischen Markt an. "Superfruit" steht auf dem Etikett der Dosen. Seit einigen Jahren kommt sie jeden Februar zur "Biofach"-Messe nach Nürnberg. Was für ein schöner Zufall: Wir werden also Gelegenheit haben, uns für ihre Gastfreundschaft zu revanchieren.

Am Abend kommen wir auch auf die Situation in Zimbabwe zu sprechen. Sarah ist gelegentlich dort, weil ihr Bruder im Süden des Landes wohnt. Wenn wir genügend Dollars bei uns hätten, würden wir gut durchkommen, sagt sie. Benzin bräuchten wir ja nicht, und zu essen würden wir genug finden, sofern wir mit der einfachen einheimischen Kost an den Garküchen zufrieden seien. Wir werden dann also hauptsächlich von Maisbrei ("Pap") leben, der mit etwas Rindfleisch oder Hühnchen und mit Gemüse serviert wird. Das ist auch hier in Südafrika schon das übliche Angebot an den Imbissständen der schwarzen Bevölkerung. Solange genügend Soße beigegeben wird, kriegt man den trockenen Maisbrei auch runter.
Und dann erwähnt ihr Mann Casper noch eine alternative Route, die nicht von Musina direkt nach Zimbabwe führt, sondern auf einem Umweg durch Botswana zum Übergang bei Plumtree. Mit zwei Vorteilen: Dieser alternative Grenzübergang sei wesentlich stressfreier, und auf den Straßen herrsche viel weniger Verkehr. Wir zögern nicht und wählen diesen 150 Kilometer längeren Weg.
Abschied von Casper, Casper junior und Owen (Foto: Sarah Venter)
Direkt vor der Zimbabwe-Grenze biegen wir in Musina links ab. Es ist ein typischer afrikanischer Grenzort. Menschentrauben sitzen am Straßenrand, umgeben von Säcken voller Lebensmittel, Kleidung, Schuhen, wartend auf die Weiterreise. Ständig stoppen und starten brechend voll beladene Minibusse wie rollende Sardinendosen. Zwielichtige Gesellen quatschen dich am Straßenrand an, gewöhnliche Einkaufsläden sind hier mit bewaffnetem Personal besonders gut gesichert.
Wir bleiben also in Südafrika und radeln parallel zum Grenzfluss Limpopo nach Westen. Mit dem Verlassen der Hauptstraße wird es sofort einsam, nur ein paar Autos begegnen uns jede Stunde. Zahllose Baobabs stehen wie massive Pfeiler in der Savanne. Auf den 100 Kilometern bis nach Botswana gibt es keine einzige Ortschaft mehr, aber einige private Wildparks mit Lodges und ganz im Westen dann den staatlichen Mapungubwe-Park. Zum Campingplatz dort gelangen wir nur mit bewaffneten Rangern - per Eskorte, wie ich sie vor zwei Wochen schon im Krüger-Park erlebt habe.
Was Casper in Louis Trichard nicht erwähnt hatte: Auf der anderen Seite der Grenze, in Botswana, schließt sich ein weiterer Wildpark an, durch den hindurch die Piste führt. Dort gibt es Löwen, Elefanten, Kaffernbüffel und allerlei mehr. Die Frage ist nun, ob wir dort überhaupt mit dem Fahrrad einreisen dürfen. Die südafrikanischen Ranger wollen diesbezüglich nicht spekulieren. Aber wenn wir an dieser Grenze nicht durchkommen, müssen wir entweder zurück nach Musina oder einen weiteren Umweg Richtung Süden machen.

Am nächsten Morgen sind die Ranger pünktlich um 7:30 Uhr da, um uns vom Campingplatz wieder zurück zur Hauptpiste zu begleiten. Ich bin optimistisch, dass uns Botswana einreisen lässt. Viel länger darf ich in Südafrika auch gar nicht bleiben. In wenigen Tagen laufen meine drei Monate Aufenthaltsrecht ab.
Ade Südafrika, du schönes Land, du zerrissenes Land. Sorgenvolle Menschen habe ich kennengelernt, Schwarze wie Weiße. Bürgerkrieg fürchten die einen, Zimbabwe-Zustände mit Landenteignungen die anderen. In 50 Jahren werde ich wiederkommen. Vielleicht ist bis dahin zusammengewachsen, was in der langen Zeit der Apartheid nicht zusammengehören durfte.












































































































